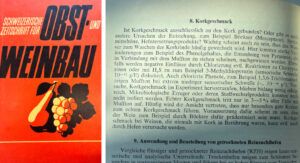Irrtum vorbehalten, widmete sich die Schweizer Zeitschrift für Obst und Wein (SZOW) im Jahr 1980 erstmals dem Phänomen des Korkgeschmacks. Autor des Artikels war ein gewisser H. Schlotter aus Bad Kreuznach, der von einem internationalen weinchemischen Kolloquium berichtete, das vom 26.–28. August 1980 in Wädenswil stattgefunden hatte. Interessanterweise sprach man immer nur vom Korkgeschmack und nicht vom Geruch.
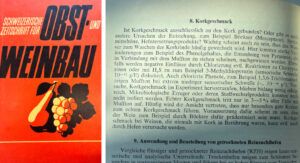
Auszug aus der SZOW 07/1980. (© O+W)
Dass es schon früher Probleme mit diesem Fehlton gab, ist sicher nicht auszuschliessen, aber vielleicht war sein Auftreten auch die Folge der industriellen Korkverarbeitung, sodass der typische Fehlton erst Ende der 1970er-Jahre richtig zum Thema wurde. Wie der Artikel belegt, wurden zuerst auch andere Kontaminenten verdächtigt. So vermutete man, dass er eventuell ein Nebenprodukt des Böcksers (Mercaptane), von Spritzmitteln oder eine Folge von Hefezersetzungprodukten sein könnte. Aber man riet ebenfalls, «dass das Wasser zum Waschen der Korkrinde häufig gewechselt wird». Dass Chlorpyrazine einen ähnlichen Muffton entwickeln können, war bekannt. Erst als weitere Option wurde das Trichloranisol (TCA) als Möglichkeit genannt, allerdings nicht das 2,4,6-TCA, sondern das 1,3,6-TCA. Der Versuch, Korkgeschmack im Experiment hervorzurufen, blieb lange erfolglos, bis Hans Tanner und sein Team es doch schafften (siehe Artikel «Verkorkte Tatsachen – dem TCA auf der Spur»). Ausserdem war man der Meinung, dass der Fehlton in lediglich 3 bis 5 % aller Fälle einen Muffton bilden würde. Viel mehr vermutete man, dass es eine Wechselwirkung sein könnte: «Voraussetzung dafür scheint zu sein, dass der Wein zum Beispiel durch Böckser dafür prädestiniert sein muss. Korkgeschmack bei Weinen, die niemals mit Kork in Berührung waren, kann evtl. auch durch Hefen verursacht werden.»
An diesem Beispiel zeigt sich auf spannende Weise, wie auch in der wissenschaftlichen Forschung der Fortschritt häufig nur schrittweise erreicht wird. Und stets gehört dazu, dass zuerst auch Umwege oder Sackgassen begangen werden müssen, bis endlich Klarheit herrscht.